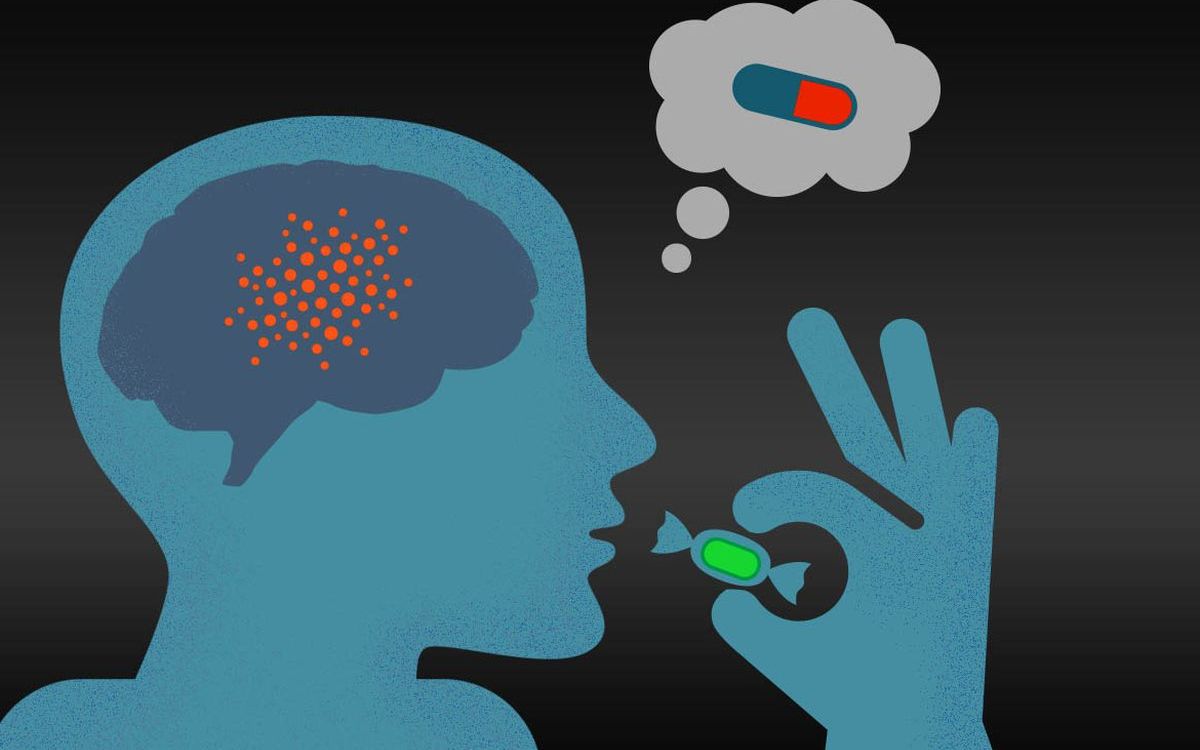Der Placeboeffekt beschreibt das Gefühl einer Verbesserung des Gesundheitszustands aufgrund positiver Erwartungen bei einer wirkungslosen Behandlung. Der entsprechende Anti-Placeboeffekt beschreibt die nachlassende Wirksamkeit von Medikamenten aufgrund negativer Erwartungen oder das Auftreten von Nebenwirkungen aufgrund negativer Erwartungen bei der Einnahme eines Placebos, was zu einer Verschlechterung des Zustands führen kann. Sie treten häufig in der klinischen Behandlung und Forschung auf und können die Wirksamkeit und den Behandlungserfolg der Patienten beeinträchtigen.
Der Placebo- und der Anti-Placebo-Effekt entstehen durch die positiven bzw. negativen Erwartungen von Patienten an ihren eigenen Gesundheitszustand. Diese Effekte können in verschiedenen klinischen Umgebungen auftreten, beispielsweise bei der Anwendung von Wirkstoffen oder Placebos in der klinischen Praxis oder bei Studien, bei der Einholung einer informierten Einwilligung, bei der Bereitstellung medizinischer Informationen und bei der Durchführung von Aktivitäten zur Förderung der öffentlichen Gesundheit. Der Placebo-Effekt führt zu positiven Ergebnissen, während der Anti-Placebo-Effekt zu schädlichen und gefährlichen Ergebnissen führt.
Die Unterschiede im Behandlungserfolg und den Symptomen bei verschiedenen Patienten können teilweise auf Placebo- und Antiplaceboeffekte zurückgeführt werden. In der klinischen Praxis lassen sich Häufigkeit und Intensität von Placeboeffekten nur schwer bestimmen, während die Bandbreite ihrer Häufigkeit und Intensität unter experimentellen Bedingungen groß ist. So ist beispielsweise in vielen doppelblinden klinischen Studien zur Behandlung von Schmerzen oder psychischen Erkrankungen die Reaktion auf Placebo ähnlich wie auf aktive Medikamente, und bis zu 19 % der Erwachsenen und 26 % der älteren Teilnehmer, die ein Placebo erhielten, berichteten von Nebenwirkungen. Darüber hinaus brachen in klinischen Studien bis zu einem Viertel der Patienten, die ein Placebo erhielten, die Einnahme des Medikaments aufgrund von Nebenwirkungen ab. Dies legt nahe, dass der Antiplaceboeffekt zum Absetzen des aktiven Medikaments oder zu mangelnder Compliance führen kann.
Die neurobiologischen Mechanismen von Placebo- und Anti-Placebo-Effekten
Der Placeboeffekt ist nachweislich mit der Freisetzung vieler Substanzen verbunden, beispielsweise endogener Opioide, Cannabinoide, Dopamin, Oxytocin und Vasopressin. Die Wirkung jeder Substanz richtet sich gegen das Zielsystem (d. h. Schmerz, Bewegung oder Immunsystem) und Krankheiten (wie Arthritis oder Parkinson). Beispielsweise ist die Dopaminfreisetzung am Placeboeffekt bei der Behandlung der Parkinson-Krankheit beteiligt, nicht jedoch am Placeboeffekt bei der Behandlung chronischer oder akuter Schmerzen.
Es wurde gezeigt, dass die durch verbale Suggestion im Experiment verursachte Schmerzverstärkung (ein Anti-Placebo-Effekt) durch das Neuropeptid Cholecystokinin vermittelt wird und durch Proglutamid (ein Typ-A- und Typ-B-Rezeptorantagonist von Cholecystokinin) blockiert werden kann. Bei gesunden Personen ist diese durch Sprache induzierte Hyperalgesie mit einer erhöhten Aktivität der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse verbunden. Das Benzodiazepin Diazepam kann Hyperalgesie und Hyperaktivität der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse antagonisieren, was darauf hindeutet, dass Angst an diesen Anti-Placebo-Effekten beteiligt ist. Alanin kann jedoch Hyperalgesie blockieren, nicht jedoch Überaktivität der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse, was darauf hindeutet, dass das Cholecystokinin-System am Hyperalgesie-Teil des Anti-Placebo-Effekts beteiligt ist, nicht jedoch am Angst-Teil. Der Einfluss der Genetik auf Placebo- und Anti-Placebo-Effekte hängt mit Haplotypen von Einzelnukleotid-Polymorphismen in Dopamin-, Opioid- und endogenen Cannabinoid-Genen zusammen.
Eine Metaanalyse auf Teilnehmerebene von 20 Studien zur funktionellen Bildgebung des Gehirns mit 603 gesunden Teilnehmern ergab, dass der mit Schmerzen verbundene Placeboeffekt nur einen geringen Einfluss auf schmerzbezogene Manifestationen in der funktionellen Bildgebung (sogenannte neurogene Schmerzsignaturen) hatte. Der Placeboeffekt könnte auf mehreren Ebenen der Gehirnnetzwerke eine Rolle spielen, die Emotionen und deren Einfluss auf multifaktorielle subjektive Schmerzerfahrungen fördern. Bildgebung von Gehirn und Rückenmark zeigt, dass der Anti-Placeboeffekt zu einer erhöhten Schmerzsignalübertragung vom Rückenmark zum Gehirn führt. Im Experiment zur Prüfung der Reaktion der Teilnehmer auf Placebocremes wurden diese Cremes als schmerzverursachend beschrieben und als teuer oder günstig eingestuft. Die Ergebnisse zeigten, dass Schmerzübertragungsregionen im Gehirn und Rückenmark aktiviert wurden, wenn die Personen nach der Behandlung mit teuren Cremes stärkere Schmerzen erwarteten. In ähnlichen Experimenten wurde wärmeinduzierter Schmerz getestet, der durch das starke Opioid Remifentanil gelindert werden kann. Bei Teilnehmern, die glaubten, dass die Einnahme von Remifentanil abgesetzt worden sei, wurde der Hippocampus aktiviert und der Anti-Placebo-Effekt blockierte die Wirksamkeit des Medikaments, was darauf hindeutet, dass Stress und Gedächtnis an diesem Effekt beteiligt waren.
Erwartungen, Sprachhinweise und Framework-Effekte
Die molekularen Ereignisse und Veränderungen neuronaler Netzwerke, die Placebo- und Anti-Placebo-Effekten zugrunde liegen, werden durch ihre erwarteten oder vorhersehbaren zukünftigen Ergebnisse vermittelt. Kann die Erwartung erfüllt werden, spricht man von Erwartung; Erwartungen lassen sich durch Veränderungen in Wahrnehmung und Kognition messen und beeinflussen. Erwartungen können auf verschiedene Weise entstehen, beispielsweise durch frühere Erfahrungen mit Arzneimittelwirkungen und Nebenwirkungen (wie die schmerzstillende Wirkung nach Einnahme von Medikamenten), mündliche Anweisungen (wie die Information, dass ein bestimmtes Medikament Schmerzen lindern kann) oder soziale Beobachtungen (wie die direkte Beobachtung einer Symptomlinderung bei anderen nach Einnahme desselben Medikaments). Einige Erwartungen sowie Placebo- und Anti-Placebo-Effekte lassen sich jedoch nicht erfüllen. So können wir beispielsweise bei Patienten nach einer Nierentransplantation bedingt immunsuppressive Reaktionen hervorrufen. Die Beweismethode besteht darin, den Patienten neutrale Reize zu verabreichen, die zuvor mit Immunsuppressiva gepaart wurden. Die alleinige Anwendung neutraler Stimulation reduziert auch die T-Zell-Proliferation.
Im klinischen Umfeld werden die Erwartungen durch die Beschreibung von Medikamenten oder den verwendeten „Rahmen“ beeinflusst. Nach einer Operation bringt es erhebliche Vorteile, wenn die Behandlung mit Morphin, die Sie erhalten, im Vergleich zu einer verdeckten Verabreichung, bei der der Patient den Verabreichungszeitpunkt nicht kennt, darauf hindeutet, dass es Schmerzen wirksam lindern kann. Direkte Hinweise auf Nebenwirkungen können sich auch selbst erfüllen. Eine Studie mit Patienten, die mit dem Betablocker Atenolol gegen Herzerkrankungen und Bluthochdruck behandelt wurden, zeigte, dass 31 % der Patienten, die bewusst über mögliche Nebenwirkungen informiert wurden, an sexuellen Nebenwirkungen und erektiler Dysfunktion litten, während die Inzidenz bei Patienten, die nicht über Nebenwirkungen informiert wurden, nur 16 % betrug. Ebenso traten bei Patienten, die Finasterid aufgrund einer gutartigen Prostatavergrößerung einnahmen, 43 % der Patienten, die explizit über sexuelle Nebenwirkungen informiert wurden, Nebenwirkungen auf, während dieser Anteil bei den Patienten, die nicht über sexuelle Nebenwirkungen informiert wurden, bei 15 % lag. Eine Studie mit Asthmapatienten, die vernebelte Kochsalzlösung inhalierten und darüber informiert wurden, dass sie Allergene inhalierten. Die Ergebnisse zeigten, dass etwa die Hälfte der Patienten unter Atembeschwerden, erhöhtem Atemwegswiderstand und verringerter Lungenkapazität litt. Unter den Asthmapatienten, die Bronchokonstriktoren inhalierten, litten diejenigen, die über Bronchokonstriktoren informiert waren, unter stärkerer Atemnot und Atemwegswiderstand als diejenigen, die über Bronchodilatatoren informiert waren.
Darüber hinaus können sprachlich induzierte Erwartungen spezifische Symptome wie Schmerzen, Juckreiz und Übelkeit hervorrufen. Nach sprachlicher Suggestion können Reize, die mit Schmerzen geringer Intensität in Zusammenhang stehen, als starke Schmerzen wahrgenommen werden, während taktile Reize als Schmerzen wahrgenommen werden können. Negative Erwartungen können nicht nur Symptome auslösen oder verschlimmern, sondern auch die Wirksamkeit aktiver Medikamente verringern. Wird Patienten die falsche Information vermittelt, dass Medikamente Schmerzen eher verschlimmern als lindern, kann dies die Wirkung lokaler Analgetika blockieren. Wird der 5-Hydroxytryptamin-Rezeptor-Agonist Rizitriptan fälschlicherweise als Placebo deklariert, kann dies seine Wirksamkeit bei der Behandlung von Migräneattacken verringern; ebenso können negative Erwartungen die analgetische Wirkung von Opioiden auf experimentell induzierte Schmerzen verringern.
Lernmechanismen bei Placebo- und Anti-Placebo-Effekten
Sowohl Lernen als auch klassische Konditionierung sind an Placebo- und Anti-Placebo-Effekten beteiligt. In vielen klinischen Situationen können neutrale Reize, die zuvor durch klassische Konditionierung mit der positiven oder negativen Wirkung von Medikamenten in Verbindung gebracht wurden, Vorteile oder Nebenwirkungen hervorrufen, ohne dass in Zukunft aktive Medikamente eingesetzt werden müssen.
Wenn beispielsweise Umwelt- oder Geschmacksreize wiederholt mit Morphin kombiniert werden, können dieselben Reize auch in Kombination mit einem Placebo anstelle von Morphin eine schmerzstillende Wirkung haben. Bei Psoriasis-Patienten, die in Intervallen Glukokortikoide in reduzierter Dosis und ein Placebo erhielten (sogenanntes dosisverlängernde Placebo), war die Rezidivrate ähnlich wie bei Patienten, die eine Glukokortikoid-Volldosis-Behandlung erhielten. In der Kontrollgruppe von Patienten, die dasselbe Kortikosteroid-Reduktionsschema erhielten, aber in Intervallen kein Placebo erhielten, war die Rezidivrate bis zu dreimal so hoch wie in der Gruppe mit fortgesetzter Placebodosis. Ähnliche Konditionierungseffekte wurden bei der Behandlung von chronischer Schlaflosigkeit und bei der Anwendung von Amphetaminen bei Kindern mit Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung berichtet.
Auch frühere Behandlungserfahrungen und Lernmechanismen sind für den Anti-Placebo-Effekt verantwortlich. 30 % der Frauen, die wegen Brustkrebs eine Chemotherapie erhalten, haben Übelkeit nach Umwelteinflüssen (wie dem Eintreffen im Krankenhaus, dem Treffen mit medizinischem Personal oder dem Betreten eines infusionsähnlichen Raums) erwartet, die vorher neutral waren, aber mit der Infusion in Verbindung gebracht wurden. Neugeborene, bei denen wiederholt Venenpunktionen durchgeführt wurden, zeigen unmittelbar nach der Reinigung ihrer Haut mit Alkohol vor der Venenpunktion Weinen und Schmerzen. Asthmapatienten Allergene in verschlossenen Behältern zu zeigen, kann Asthmaanfälle auslösen. Wenn eine Flüssigkeit mit einem bestimmten Geruch, aber ohne positive biologische Wirkung, zuvor mit einem aktiven Medikament mit erheblichen Nebenwirkungen (wie trizyklischen Antidepressiva) kombiniert wurde, kann die Verwendung dieser Flüssigkeit zusammen mit einem Placebo ebenfalls Nebenwirkungen hervorrufen. Wenn visuelle Reize (wie Licht und Bilder) zuvor mit experimentell induziertem Schmerz kombiniert wurden, kann die Verwendung dieser visuellen Reize allein in Zukunft auch Schmerzen auslösen.
Das Wissen um die Erfahrungen anderer kann ebenfalls zu Placebo- und Anti-Placebo-Effekten führen. Die Schmerzlinderung bei anderen kann ebenfalls einen Placebo-schmerzstillenden Effekt auslösen, der in seiner Stärke dem schmerzstillenden Effekt ähnelt, den man selbst vor der Behandlung erfahren hat. Es gibt experimentelle Hinweise darauf, dass das soziale Umfeld und Demonstrationen Nebenwirkungen hervorrufen können. Wenn Teilnehmer beispielsweise Zeuge werden, wie andere über die Nebenwirkungen eines Placebos berichten, über Schmerzen nach der Anwendung einer inaktiven Salbe berichten oder Raumluft einatmen, die als „potenziell toxisch“ beschrieben wird, kann dies auch bei Teilnehmern, die demselben Placebo, derselben inaktiven Salbe oder derselben Raumluft ausgesetzt sind, zu Nebenwirkungen führen.
Berichte in Massenmedien und Laienmedien, Informationen aus dem Internet und der direkte Kontakt mit anderen symptomatischen Personen können die Anti-Placebo-Reaktion fördern. So korreliert beispielsweise die Melderate von Nebenwirkungen von Statinen mit der Intensität negativer Berichterstattung über Statine. Ein besonders anschauliches Beispiel: Die Zahl der gemeldeten Nebenwirkungen stieg um das 2000-fache, nachdem negative Medien- und Fernsehberichte auf schädliche Veränderungen in der Formel eines Schilddrüsenmedikaments hingewiesen hatten und sich dabei nur auf bestimmte in den negativen Berichten erwähnte Symptome bezogen. Ähnlich verhält es sich, wenn durch öffentliche Werbung Anwohner fälschlicherweise glauben, sie seien giftigen Substanzen oder gefährlichen Abfällen ausgesetzt. Daraufhin steigt die Zahl der Symptome, die auf diese eingebildete Belastung zurückgeführt werden.
Der Einfluss von Placebo- und Anti-Placebo-Effekten auf Forschung und klinische Praxis
Es kann hilfreich sein, zu Beginn der Behandlung festzustellen, wer anfällig für Placebo- und Antiplaceboeffekte ist. Einige mit diesen Reaktionen verbundene Merkmale sind bereits bekannt, doch künftige Forschung kann diese Merkmale besser empirisch belegen. Optimismus und Suggestibilität scheinen nicht eng mit der Reaktion auf Placebos zusammenzuhängen. Es gibt Hinweise darauf, dass der Antiplaceboeffekt im Vergleich zu Patienten, die aktive Medikamente einnehmen, eher bei ängstlicheren Patienten auftritt, bei Patienten, die bereits Symptome aus unbekannten medizinischen Gründen hatten oder unter erheblicher psychischer Belastung leiden. Derzeit gibt es keine eindeutigen Beweise für die Rolle des Geschlechts bei Placebo- oder Antiplaceboeffekten. Bildgebung, Multigenrisiko, genomweite Assoziationsstudien und Zwillingsstudien können helfen zu klären, wie Gehirnmechanismen und Genetik zu biologischen Veränderungen führen, die als Grundlage für Placebo- und Antiplaceboeffekte dienen.
Die Interaktion zwischen Patienten und Ärzten kann die Wahrscheinlichkeit von Placeboeffekten und die berichteten Nebenwirkungen nach der Einnahme von Placebos und aktiven Medikamenten beeinflussen. Das Vertrauen der Patienten in die Ärzte und ihre gute Beziehung sowie eine ehrliche Kommunikation zwischen Patienten und Ärzten lindern nachweislich die Symptome. Daher sind die Symptome einer Erkältung bei Patienten, die glauben, dass Ärzte einfühlsam sind und über mildere und kürzere Symptome berichten, als bei Patienten, die glauben, dass Ärzte nicht einfühlsam sind; Patienten, die glauben, dass Ärzte einfühlsam sind, erleben auch eine Abnahme objektiver Entzündungsindikatoren wie Interleukin-8 und Neutrophilenzahl. Auch die positiven Erwartungen der Ärzte spielen beim Placeboeffekt eine Rolle. Eine kleine Studie, in der die Behandlung mit Anästhetika und Placebo nach einer Zahnextraktion verglichen wurde, zeigte, dass sich die Ärzte bewusst waren, dass die Schmerzlinderung bei Patienten, die Analgetika erhielten, größer war.
Wenn wir den Placeboeffekt nutzen wollen, um die Behandlungsergebnisse zu verbessern, ohne einen paternalistischen Ansatz zu verfolgen, besteht eine Möglichkeit darin, die Behandlung realistisch, aber positiv zu beschreiben. Erhöhte Erwartungen an den therapeutischen Nutzen verbessern nachweislich die Reaktion der Patienten auf Morphin, Diazepam, Tiefe Hirnstimulation, intravenöse Gabe von Remifentanil, lokale Gabe von Lidocain, komplementäre und integrierte Therapien (wie Akupunktur) und sogar Operationen.
Die Untersuchung der Patientenerwartungen ist der erste Schritt zur Integration dieser Erwartungen in die klinische Praxis. Bei der Bewertung der erwarteten klinischen Ergebnisse können Patienten gebeten werden, ihren erwarteten therapeutischen Nutzen anhand einer Skala von 0 (kein Nutzen) bis 100 (maximal vorstellbarer Nutzen) einzuschätzen. Indem Patienten ihre Erwartungen an eine elektive Herzoperation verständlich gemacht werden, verringert sich die Beeinträchtigung sechs Monate nach der Operation. Durch die Beratung von Patienten zu Bewältigungsstrategien vor intraabdominalen Operationen konnten postoperative Schmerzen und die Dosierung der Anästhesiemedikamente signifikant (um 50 %) reduziert werden. Um diese Rahmeneffekte zu nutzen, muss den Patienten nicht nur die Eignung der Behandlung erklärt werden, sondern auch, wie hoch der Anteil der Patienten ist, die davon profitieren. Beispielsweise kann die Betonung der Wirksamkeit von Medikamenten den Bedarf an postoperativen Analgetika, die die Patienten selbst kontrollieren können, reduzieren.
In der klinischen Praxis gibt es möglicherweise andere ethische Möglichkeiten, den Placeboeffekt zu nutzen. Einige Studien belegen die Wirksamkeit der „Open-Label-Placebo“-Methode. Dabei wird dem Wirkstoff zusätzlich ein Placebo verabreicht und die Patienten werden ehrlich darüber informiert, dass die zusätzliche Gabe eines Placebos die positive Wirkung des Wirkstoffs nachweislich verstärkt und somit dessen Wirksamkeit steigert. Darüber hinaus ist es möglich, die Wirksamkeit des Wirkstoffs durch Konditionierung bei gleichzeitiger schrittweiser Dosisreduzierung aufrechtzuerhalten. Die spezifische Operationsmethode besteht darin, das Medikament mit sensorischen Reizen zu kombinieren, was insbesondere bei toxischen oder suchterzeugenden Medikamenten nützlich ist.
Im Gegenteil: Beunruhigende Informationen, falsche Annahmen, pessimistische Erwartungen, negative Erfahrungen aus der Vergangenheit, soziale Informationen und das Behandlungsumfeld können zu Nebenwirkungen führen und den Nutzen symptomatischer und palliativer Behandlung mindern. Unspezifische Nebenwirkungen aktiver Medikamente (intermittierend, heterogen, dosisunabhängig und unzuverlässig reproduzierbar) sind häufig. Diese Nebenwirkungen können dazu führen, dass Patienten den vom Arzt verordneten Behandlungsplan (oder Absetzplan) nicht einhalten und auf ein anderes Medikament umsteigen oder weitere Medikamente einnehmen müssen, um diese Nebenwirkungen zu behandeln. Obwohl weitere Forschung erforderlich ist, um einen klaren Zusammenhang zwischen diesen beiden Faktoren festzustellen, könnten diese unspezifischen Nebenwirkungen durch den Anti-Placebo-Effekt verursacht werden.
Es kann hilfreich sein, dem Patienten die Nebenwirkungen zu erklären und gleichzeitig die Vorteile hervorzuheben. Es kann auch hilfreich sein, die Nebenwirkungen unterstützend und nicht irreführend zu beschreiben. Beispielsweise kann die Erklärung des Anteils der Patienten ohne Nebenwirkungen statt des Anteils der Patienten mit Nebenwirkungen die Häufigkeit dieser Nebenwirkungen verringern.
Ärzte sind verpflichtet, vor der Einleitung einer Behandlung eine gültige Einverständniserklärung ihres Patienten einzuholen. Im Rahmen dieser Einverständniserklärung müssen Ärzte ihre Patienten umfassend informieren, um ihnen eine fundierte Entscheidung zu ermöglichen. Sie müssen alle potenziell gefährlichen und klinisch relevanten Nebenwirkungen klar und deutlich erklären und ihre Patienten darüber informieren, dass alle Nebenwirkungen gemeldet werden müssen. Die Auflistung harmloser und unspezifischer Nebenwirkungen, die keiner ärztlichen Behandlung bedürfen, erhöht jedoch die Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens und stellt Ärzte vor ein Dilemma. Eine mögliche Lösung besteht darin, Patienten auf den Anti-Placebo-Effekt hinzuweisen und sie dann zu fragen, ob sie bereit sind, etwas über die harmlosen, unspezifischen Nebenwirkungen der Behandlung zu erfahren, nachdem sie davon erfahren haben. Diese Methode wird als „kontextualisierte Einverständniserklärung“ und „autorisierte Berücksichtigung“ bezeichnet.
Es kann hilfreich sein, diese Probleme gemeinsam mit den Patienten zu erörtern, da falsche Annahmen, beunruhigende Erwartungen und negative Erfahrungen mit früheren Medikamenten zu einem Anti-Placebo-Effekt führen können. Welche lästigen oder gefährlichen Nebenwirkungen hatten sie zuvor? Welche Nebenwirkungen bereiten ihnen Sorgen? Falls sie derzeit unter harmlosen Nebenwirkungen leiden, wie stark schätzen sie diese ein? Erwarten sie, dass sich die Nebenwirkungen mit der Zeit verschlimmern? Die Antworten der Patienten können Ärzten helfen, ihre Bedenken hinsichtlich der Nebenwirkungen zu zerstreuen und so die Behandlung erträglicher zu machen. Ärzte können Patienten versichern, dass Nebenwirkungen zwar lästig sein können, aber eigentlich harmlos und medizinisch nicht gefährlich sind, wodurch die Angst, die Nebenwirkungen auslöst, gelindert werden kann. Im Gegenteil: Wenn die Interaktion zwischen Patienten und behandelnden Ärzten ihre Angst nicht lindern oder sie sogar verschlimmern kann, werden die Nebenwirkungen verstärkt. Eine qualitative Überprüfung experimenteller und klinischer Studien legt nahe, dass negatives nonverbales Verhalten und gleichgültige Kommunikationsmethoden (wie einfühlsame Sprache, fehlender Augenkontakt mit Patienten, monotone Sprache und kein Lächeln im Gesicht) den Anti-Placebo-Effekt fördern, die Schmerztoleranz der Patienten verringern und den Placebo-Effekt reduzieren können. Bei den vermuteten Nebenwirkungen handelt es sich häufig um Symptome, die zuvor übersehen oder übersehen wurden, nun aber dem Medikament zugeschrieben werden. Die Korrektur dieser fehlerhaften Attribution kann das Medikament verträglicher machen.
Die von Patienten berichteten Nebenwirkungen können nonverbal und verdeckt geäußert werden und auf Zweifel, Vorbehalte oder Ängste hinsichtlich des Medikaments, des Behandlungsplans oder der fachlichen Fähigkeiten des Arztes hinweisen. Im Vergleich zur direkten Äußerung von Zweifeln gegenüber dem behandelnden Arzt sind Nebenwirkungen ein weniger peinlicher und leicht zu akzeptierender Grund für den Abbruch der Medikation. In diesen Situationen kann die Klärung und offene Diskussion der Bedenken des Patienten dazu beitragen, Abbrüche oder mangelnde Compliance zu vermeiden.
Die Erforschung von Placebo- und Anti-Placebo-Effekten ist für die Konzeption und Durchführung klinischer Studien sowie für die Interpretation der Ergebnisse von Bedeutung. Erstens sollten klinische Studien, soweit möglich, interventionsfreie Interventionsgruppen einbeziehen, um Störfaktoren im Zusammenhang mit Placebo- und Anti-Placebo-Effekten, wie z. B. den mittleren Symptomregressionswert, zu erklären. Zweitens beeinflusst das Längsschnittdesign der Studie die Häufigkeit des Placebo-Ansprechens, insbesondere im Crossover-Design. Bei Teilnehmern, die zuerst das aktive Medikament erhielten, weckten frühere positive Erfahrungen Erwartungen, während dies bei Teilnehmern, die zuerst das Placebo erhielten, nicht der Fall war. Da die Aufklärung der Patienten über die spezifischen Vorteile und Nebenwirkungen der Behandlung die Häufigkeit dieser Vorteile und Nebenwirkungen erhöhen kann, ist es ratsam, die im Rahmen der Einwilligungserklärung bereitgestellten Informationen zu Vorteilen und Nebenwirkungen in allen Studien zu einem bestimmten Medikament konsistent zu halten. In Metaanalysen, in denen die Informationen nicht konsistent sind, sollten die Ergebnisse mit Vorsicht interpretiert werden. Forscher, die Daten zu Nebenwirkungen erheben, sollten weder die Behandlungsgruppe noch die Nebenwirkungssituation kennen. Bei der Erhebung von Daten zu Nebenwirkungen ist eine strukturierte Symptomliste besser als eine offene Befragung.
Veröffentlichungszeit: 29. Juni 2024