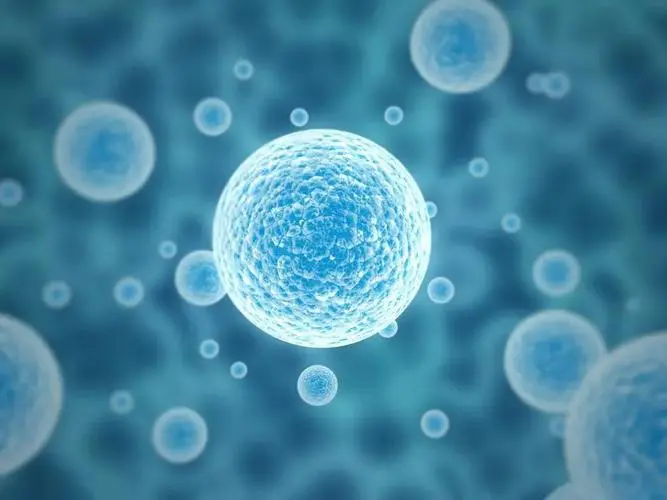Die Sauerstofftherapie ist eine der am häufigsten verwendeten Methoden in der modernen Medizin, aber es gibt immer noch Missverständnisse über die Indikationen für die Sauerstofftherapie, und die unsachgemäße Verwendung von Sauerstoff kann schwere toxische Reaktionen hervorrufen
Klinische Bewertung der Gewebehypoxie
Die klinischen Manifestationen einer Gewebehypoxie sind vielfältig und unspezifisch. Zu den auffälligsten Symptomen zählen Dyspnoe, Kurzatmigkeit, Tachykardie, Atemnot, schnelle Veränderungen des Geisteszustands und Arrhythmie. Zur Feststellung einer Gewebehypoxie (viszerale Hypoxie) sind Serumlaktat (erhöht bei Ischämie und reduziertem Herzzeitvolumen) und SvO2 (erniedrigt bei reduziertem Herzzeitvolumen, Anämie, arterieller Hypoxämie und hohem Stoffwechsel) hilfreich. Da Laktat auch ohne Hypoxie erhöht sein kann, lässt sich die Diagnose nicht allein auf Grundlage eines Laktatanstiegs stellen, da Laktat auch unter Bedingungen erhöhter Glykolyse erhöht sein kann, beispielsweise bei schnellem Wachstum maligner Tumoren, früher Sepsis, Stoffwechselstörungen und Katecholamingabe. Andere Laborwerte, die auf eine bestimmte Organfunktionsstörung hinweisen, sind ebenfalls wichtig, wie erhöhte Kreatinin-, Troponin- oder Leberenzyme.
Klinische Bewertung des arteriellen Sauerstoffstatus
Zyanose. Zyanose ist normalerweise ein Symptom, das im Spätstadium einer Hypoxie auftritt und bei der Diagnose von Hypoxämie und Hypoxie oft unzuverlässig ist, da sie bei Anämie und schlechter Durchblutung möglicherweise nicht auftritt und es für Menschen mit dunklerer Haut schwierig ist, eine Zyanose zu erkennen.
Pulsoximetrie-Überwachung. Die nichtinvasive Pulsoximetrie wird häufig zur Überwachung aller Krankheiten eingesetzt. Der ermittelte SaO2-Wert wird als SpO2 bezeichnet. Das Prinzip der Pulsoximetrie-Überwachung basiert auf dem Bill'schen Gesetz, das besagt, dass die Konzentration einer unbekannten Substanz in einer Lösung anhand ihrer Lichtabsorption bestimmt werden kann. Wenn Licht durch Gewebe dringt, wird der größte Teil des Lichts von den Gewebebestandteilen und dem Blut absorbiert. Bei jedem Herzschlag pulsiert das arterielle Blut jedoch, sodass der Pulsoximetrie-Monitor Änderungen der Lichtabsorption bei zwei Wellenlängen erkennen kann: 660 Nanometer (rot) und 940 Nanometer (infrarot). Die Absorptionsraten von reduziertem Hämoglobin und sauerstoffreichem Hämoglobin unterscheiden sich bei diesen beiden Wellenlängen. Nach Abzug der Absorption des nicht pulsierenden Gewebes kann die Konzentration des sauerstoffreichen Hämoglobins im Verhältnis zum Gesamthämoglobin berechnet werden.
Die Überwachung der Pulsoximetrie unterliegt einigen Einschränkungen. Substanzen im Blut, die diese Wellenlängen absorbieren, können die Messgenauigkeit beeinträchtigen. Dazu gehören erworbene Hämoglobinopathien – Carboxyhämoglobin und Methämoglobinämie, Methylenblau und bestimmte genetische Hämoglobinvarianten. Die Absorption von Carboxyhämoglobin bei einer Wellenlänge von 660 Nanometern ähnelt der von sauerstoffhaltigem Hämoglobin; bei einer Wellenlänge von 940 Nanometern ist die Absorption sehr gering. Daher bleibt die SpO2 unabhängig von der relativen Konzentration von kohlenmonoxidgesättigtem Hämoglobin und sauerstoffgesättigtem Hämoglobin konstant (90 %–95 %). Bei Methämoglobinämie gleicht Methämoglobin die Absorptionskoeffizienten zweier Wellenlängen aus, wenn Hämeisen zu Eisen(II) oxidiert wird. Dies führt dazu, dass die SpO2 innerhalb eines relativ weiten Konzentrationsbereichs von Methämoglobin nur im Bereich von 83 % bis 87 % schwankt. In diesem Fall werden für die Messung des arteriellen Blutsauerstoffs vier Lichtwellenlängen benötigt, um zwischen den vier Hämoglobinformen zu unterscheiden.
Die Pulsoximetrie-Überwachung beruht auf einem ausreichenden pulsierenden Blutfluss. Daher kann die Pulsoximetrie-Überwachung nicht bei Schockhypoperfusion oder bei Verwendung nicht pulsierender Herzunterstützungssysteme (bei denen das Herzzeitvolumen nur einen kleinen Teil des Herzzeitvolumens ausmacht) eingesetzt werden. Bei schwerer Trikuspidalinsuffizienz ist die Desoxyhämoglobinkonzentration im venösen Blut hoch, und die Pulsation des venösen Blutes kann zu niedrigen Blutsauerstoffsättigungswerten führen. Bei schwerer arterieller Hypoxämie (SaO2 < 75 %) kann die Genauigkeit ebenfalls abnehmen, da diese Technik in diesem Bereich nie validiert wurde. Und schließlich erkennen immer mehr Menschen, dass die Pulsoximetrie-Überwachung die arterielle Hämoglobinsättigung bei Personen mit dunklerer Haut je nach verwendetem Gerät um bis zu 5–10 Prozentpunkte überschätzen kann.
PaO2/FIO2. Das PaO2/FIO2-Verhältnis (allgemein als P/F-Verhältnis bezeichnet, mit einem Wert zwischen 400 und 500 mmHg) gibt den Grad des abnormalen Sauerstoffaustauschs in der Lunge wieder und ist in diesem Zusammenhang besonders nützlich, da sich der FIO2 durch mechanische Beatmung genau einstellen lässt. Ein AP/F-Verhältnis unter 300 mmHg weist auf klinisch signifikante Gasaustauschstörungen hin, während ein P/F-Verhältnis unter 200 mmHg auf eine schwere Hypoxämie hinweist. Zu den Faktoren, die das P/F-Verhältnis beeinflussen, gehören Beatmungseinstellungen, positiver endexspiratorischer Druck und FIO2. Die Auswirkungen von FIO2-Änderungen auf das P/F-Verhältnis variieren je nach Art der Lungenverletzung, Shunt-Fraktion und Umfang der FIO2-Änderungen. Liegt kein PaO2 vor, kann SpO2/FIO2 als sinnvoller alternativer Indikator dienen.
Differenz des alveolären arteriellen Sauerstoffpartialdrucks (Aa PO2). Die Differenzmessung des Aa PO2 ist die Differenz zwischen dem berechneten alveolären Sauerstoffpartialdruck und dem gemessenen arteriellen Sauerstoffpartialdruck und wird zur Messung der Effizienz des Gasaustauschs verwendet.
Die „normale“ Aa PO2-Differenz beim Einatmen von Umgebungsluft auf Meereshöhe variiert mit dem Alter und liegt zwischen 10 und 25 mmHg (2,5 + 0,21 x Alter [Jahre]). Der zweite Einflussfaktor ist FIO2 oder PAO2. Steigt einer dieser beiden Faktoren, vergrößert sich auch die Aa PO2-Differenz. Das liegt daran, dass der Gasaustausch in den Alveolarkapillaren im flacheren Teil (Steigung) der Hämoglobin-Sauerstoff-Dissoziationskurve stattfindet. Bei gleichem Grad der venösen Durchmischung vergrößert sich die PO2-Differenz zwischen gemischtem venösem und arteriellem Blut. Ist hingegen der alveoläre PO2 aufgrund unzureichender Belüftung oder großer Höhe niedrig, ist die Aa-Differenz niedriger als normal, was zu einer Unterschätzung oder ungenauen Diagnose einer Lungenfunktionsstörung führen kann.
Oxygenierungsindex. Der Oxygenierungsindex (OI) kann bei mechanisch beatmeten Patienten verwendet werden, um die erforderliche Beatmungsintensität zur Aufrechterhaltung der Sauerstoffsättigung zu bestimmen. Er umfasst den mittleren Atemwegsdruck (MAP, in cm H2O), FIO2 und PaO2 (in mm Hg) oder SpO2 und kann, wenn er 40 übersteigt, als Standard für die extrakorporale Membranoxygenierungstherapie verwendet werden. Normalwert unter 4 cm H2O/mm Hg; Aufgrund des einheitlichen Wertes von cm H2O/mm Hg (1,36) werden bei der Angabe dieses Verhältnisses üblicherweise keine Einheiten angegeben.
Indikationen für die akute Sauerstofftherapie
Bei Patienten mit Atembeschwerden ist in der Regel eine Sauerstoffgabe erforderlich, bevor eine Hypoxämie diagnostiziert wird. Liegt der arterielle Sauerstoffpartialdruck (PaO2) unter 60 mmHg, ist das deutlichste Anzeichen für eine Sauerstoffaufnahme eine arterielle Hypoxämie, die typischerweise einer arteriellen Sauerstoffsättigung (SaO2) oder peripheren Sauerstoffsättigung (SpO2) von 89 % bis 90 % entspricht. Sinkt der PaO2-Wert unter 60 mmHg, kann die Blutsauerstoffsättigung stark abnehmen, was zu einer signifikanten Abnahme des arteriellen Sauerstoffgehalts und möglicherweise zu Gewebehypoxie führt.
Zusätzlich zur arteriellen Hypoxämie kann in seltenen Fällen eine Sauerstoffsupplementierung notwendig sein. Bei schwerer Anämie, Traumata und Patienten nach kritischen Operationen kann die Gewebehypoxie durch Erhöhung des arteriellen Sauerstoffspiegels reduziert werden. Bei Patienten mit Kohlenmonoxidvergiftung (CO) kann die Sauerstoffsupplementierung den gelösten Sauerstoffgehalt im Blut erhöhen, an Hämoglobin gebundenes CO ersetzen und den Anteil an sauerstoffhaltigem Hämoglobin erhöhen. Nach dem Einatmen von reinem Sauerstoff beträgt die Halbwertszeit von Carboxyhämoglobin 70–80 Minuten, während die Halbwertszeit beim Einatmen von Umgebungsluft 320 Minuten beträgt. Unter hyperbaren Sauerstoffbedingungen verkürzt sich die Halbwertszeit von Carboxyhämoglobin nach dem Einatmen von reinem Sauerstoff auf weniger als 10 Minuten. Hyperbarer Sauerstoff wird im Allgemeinen in Situationen mit hohen Carboxyhämoglobinspiegeln (> 25 %), Herzischämie oder sensorischen Anomalien eingesetzt.
Trotz fehlender oder ungenauer Datenlage kann auch bei anderen Erkrankungen eine Sauerstoffgabe hilfreich sein. Sauerstofftherapie wird häufig bei Clusterkopfschmerzen, Sichelzellanämie, zur Linderung von Atemnot ohne Hypoxämie, Pneumothorax und Mediastinalemphysem (zur Förderung der Luftaufnahme im Brustkorb) eingesetzt. Es gibt Hinweise darauf, dass eine intraoperative Sauerstoffzufuhr das Auftreten von Wundinfektionen reduzieren kann. Postoperative Übelkeit/Erbrechen scheint die Sauerstoffgabe jedoch nicht wirksam zu reduzieren.
Mit der Verbesserung der ambulanten Sauerstoffversorgungskapazitäten nimmt auch der Einsatz der Langzeit-Sauerstofftherapie (LTOT) zu. Die Standards für die Durchführung der Langzeit-Sauerstofftherapie sind bereits sehr klar. Die Langzeit-Sauerstofftherapie wird häufig bei chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) eingesetzt.
Zwei Studien an Patienten mit hypoxämischer COPD liefern unterstützende Daten für LTOT. Die erste Studie war der Nocturnal Oxygen Therapy Trial (NOTT) aus dem Jahr 1980, bei dem die Patienten nach dem Zufallsprinzip entweder einer nächtlichen (mindestens 12 Stunden) oder einer kontinuierlichen Sauerstofftherapie zugeteilt wurden. Nach 12 und 24 Monaten haben Patienten, die nur nachts eine Sauerstofftherapie erhalten, eine höhere Sterblichkeitsrate. Das zweite Experiment war der Medical Research Council Family Trial aus dem Jahr 1981, bei dem die Patienten nach dem Zufallsprinzip in zwei Gruppen aufgeteilt wurden: diejenigen, die keinen Sauerstoff erhielten, und diejenigen, die mindestens 15 Stunden pro Tag Sauerstoff erhielten. Ähnlich wie beim NOTT-Test war die Sterblichkeitsrate in der anaeroben Gruppe signifikant höher. Die Probanden beider Studien waren Nichtraucher, die eine Maximalbehandlung erhielten und in stabilem Zustand waren, mit einem PaO2 unter 55 mmHg, oder Patienten mit Polyzythämie oder pulmonaler Herzerkrankung und einem PaO2 unter 60 mmHg.
Diese beiden Experimente zeigen, dass eine Sauerstoffgabe über mehr als 15 Stunden pro Tag besser ist als gar keine Sauerstoffzufuhr und dass eine kontinuierliche Sauerstofftherapie besser ist als eine Behandlung nur nachts. Die Einschlusskriterien dieser Studien bilden die Grundlage für die Entwicklung von LTOT-Leitlinien durch die Krankenkassen und die ATS. Man kann davon ausgehen, dass LTOT auch für andere hypoxische Herz-Kreislauf-Erkrankungen anerkannt ist, es fehlen jedoch derzeit entsprechende experimentelle Belege. Eine aktuelle Multicenterstudie konnte keinen Unterschied im Einfluss der Sauerstofftherapie auf Mortalität oder Lebensqualität bei COPD-Patienten mit Hypoxämie feststellen, die die Ruhekriterien nicht erfüllte oder nur durch körperliche Betätigung verursacht wurde.
Ärzte verschreiben Patienten, deren Blutsauerstoffsättigung während des Schlafs stark abnimmt, manchmal eine nächtliche Sauerstoffsupplementierung. Derzeit gibt es keine eindeutigen Belege für die Anwendung dieser Methode bei Patienten mit obstruktiver Schlafapnoe. Bei Patienten mit obstruktiver Schlafapnoe oder dem Adipositas-Hypopnoe-Syndrom, die zu nächtlicher Atmungsbeschwerden führen, ist die nicht-invasive Überdruckbeatmung anstelle der Sauerstoffsupplementierung die Hauptbehandlungsmethode.
Ein weiterer zu berücksichtigender Punkt ist, ob während einer Flugreise eine Sauerstoffergänzung erforderlich ist. Die meisten Verkehrsflugzeuge erhöhen den Kabinendruck üblicherweise auf eine Höhe, die 8000 Fuß entspricht, mit einer eingeatmeten Sauerstoffspannung von etwa 108 mmHg. Bei Patienten mit Lungenerkrankungen kann eine Abnahme der eingeatmeten Sauerstoffspannung (PiO2) Hypoxämie verursachen. Vor Reiseantritt sollten sich die Patienten einer umfassenden medizinischen Untersuchung unterziehen, einschließlich einer arteriellen Blutgasanalyse. Wenn der PaO2 des Patienten am Boden ≥ 70 mmHg (SpO2 > 95 %) beträgt, liegt sein PaO2 während des Fluges wahrscheinlich über 50 mmHg, was im Allgemeinen als ausreichend für minimale körperliche Aktivität angesehen wird. Bei Patienten mit niedriger SpO2 oder PaO2 kann ein 6-Minuten-Gehtest oder ein Hypoxie-Simulationstest in Betracht gezogen werden, bei dem typischerweise 15 % Sauerstoff geatmet werden. Wenn während einer Flugreise eine Hypoxämie auftritt, kann Sauerstoff über eine Nasenkanüle verabreicht werden, um die Sauerstoffaufnahme zu erhöhen.
Biochemische Grundlagen der Sauerstoffvergiftung
Sauerstofftoxizität wird durch die Produktion reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) verursacht. ROS ist ein von Sauerstoff abgeleitetes freies Radikal mit einem ungepaarten Orbitalelektron, das mit Proteinen, Lipiden und Nukleinsäuren reagieren, deren Struktur verändern und Zellschäden verursachen kann. Während des normalen mitochondrialen Stoffwechsels wird eine geringe Menge ROS als Signalmolekül produziert. Immunzellen nutzen ROS auch zur Abtötung von Krankheitserregern. Zu den ROS gehören Superoxid, Wasserstoffperoxid (H2O2) und Hydroxylradikale. Übermäßige ROS überfordern unweigerlich die zellulären Abwehrfunktionen und führen zum Tod oder zur Zellschädigung.
Um die durch die ROS-Bildung verursachten Schäden zu begrenzen, kann der antioxidative Schutzmechanismus der Zellen freie Radikale neutralisieren. Superoxiddismutase wandelt Superoxid in H2O2 um, das wiederum durch Katalase und Glutathionperoxidase in H2O und O2 umgewandelt wird. Glutathion ist ein wichtiges Molekül zur Begrenzung von ROS-Schäden. Weitere antioxidative Moleküle sind Alpha-Tocopherol (Vitamin E), Ascorbinsäure (Vitamin C), Phospholipide und Cystein. Das menschliche Lungengewebe enthält hohe Konzentrationen extrazellulärer Antioxidantien und Superoxiddismutase-Isoenzyme, wodurch es bei Kontakt mit höheren Sauerstoffkonzentrationen weniger toxisch ist als andere Gewebe.
Hyperoxiebedingte ROS-vermittelte Lungenschädigungen lassen sich in zwei Stadien unterteilen. Zunächst gibt es die exsudative Phase, die durch das Absterben von Alveolarepithelzellen Typ 1 und Endothelzellen, interstitielle Ödeme und die Ansammlung exsudativer Neutrophiler in den Alveolen gekennzeichnet ist. Anschließend folgt eine Proliferationsphase, in der Endothelzellen und Typ 2-Epithelzellen proliferieren und die zuvor freiliegende Basalmembran bedecken. Charakteristisch für die Erholungsphase nach Sauerstoffschädigung sind Fibroblastenproliferation und interstitielle Fibrose, wobei das Kapillarendothel und das Alveolarepithel jedoch noch annähernd normal aussehen.
Klinische Manifestationen der pulmonalen Sauerstofftoxizität
Ab welcher Expositionsstufe Toxizität auftritt, ist noch unklar. Bei einem FIO2-Wert unter 0,5 tritt in der Regel keine klinische Toxizität auf. Frühe Studien am Menschen haben gezeigt, dass die Exposition gegenüber nahezu 100 % Sauerstoff zu sensorischen Störungen, Übelkeit und Bronchitis führen sowie die Lungenkapazität, die Lungendiffusionskapazität, die Lungencompliance, den PaO2-Wert und den pH-Wert verringern kann. Weitere mit Sauerstofftoxizität verbundene Probleme sind resorptive Atelektase, sauerstoffinduzierte Hyperkapnie, akutes Atemnotsyndrom (ARDS) und neonatale bronchopulmonale Dysplasie (BPD).
Absorbierende Atelektase. Stickstoff ist ein inertes Gas, das im Vergleich zu Sauerstoff sehr langsam in den Blutkreislauf diffundiert und somit zur Aufrechterhaltung der Alveolarerweiterung beiträgt. Bei Verwendung von 100 % Sauerstoff kann Stickstoffmangel in Bereichen mit niedrigerem alveolären Ventilations-Perfusionsverhältnis (V/Q) zu einem Alveolarkollaps führen, da die Sauerstoffabsorptionsrate die Frischgaszufuhrrate übersteigt. Insbesondere während chirurgischer Eingriffe können Narkose und Lähmung zu einer Beeinträchtigung der verbleibenden Lungenfunktion führen, was den Kollaps kleiner Atemwege und Alveolen fördert und so zu einer raschen Atelektase führt.
Sauerstoffinduzierte Hyperkapnie. Patienten mit schwerer COPD neigen zu schwerer Hyperkapnie, wenn sie im Zuge einer Verschlechterung ihres Zustands hohen Sauerstoffkonzentrationen ausgesetzt sind. Der Mechanismus dieser Hyperkapnie besteht darin, dass die Fähigkeit der Hypoxämie, die Atmung anzutreiben, gehemmt wird. Bei jedem Patienten spielen jedoch zwei weitere Mechanismen in unterschiedlichem Ausmaß eine Rolle.
Die Hypoxämie bei COPD-Patienten ist die Folge eines niedrigen alveolären Sauerstoffpartialdrucks (PAO2) im niedrigen V/Q-Bereich. Um den Einfluss dieser Bereiche mit niedrigem V/Q auf die Hypoxämie zu minimieren, leiten zwei Reaktionen des Lungenkreislaufs – die hypoxische pulmonale Vasokonstriktion (HPV) und die hyperkapnische pulmonale Vasokonstriktion – den Blutfluss in gut belüftete Bereiche um. Erhöht eine Sauerstoffgabe den PAO2-Wert, sinkt die HPV deutlich, wodurch die Durchblutung in diesen Bereichen zunimmt und Bereiche mit niedrigeren V/Q-Verhältnissen entstehen. Diese Lungengewebe sind nun sauerstoffreich, können CO2 jedoch schlechter ausscheiden. Die erhöhte Durchblutung dieser Lungengewebe geht auf Kosten besser belüfteter Bereiche, die nicht mehr so viel CO2 abgeben können wie zuvor, was zu Hyperkapnie führt.
Ein weiterer Grund ist der abgeschwächte Haldane-Effekt. Sauerstoffarmes Blut kann im Vergleich zu sauerstoffreichem Blut mehr CO2 transportieren. Sauerstoffarmes Hämoglobin bindet mehr Protonen (H+) und CO2 in Form von Aminoestern. Mit sinkender Desoxyhämoglobinkonzentration während der Sauerstofftherapie sinkt auch die Pufferkapazität von CO2 und H+. Dies schwächt die CO2-Transportfähigkeit des venösen Blutes und führt zu einem Anstieg des PaCO2.
Bei der Sauerstoffversorgung von Patienten mit chronischer CO2-Retention oder Hochrisikopatienten, insbesondere bei extremer Hypoxämie, ist eine Feineinstellung des FIO2 äußerst wichtig, um die SpO2 im Bereich von 88–90 % zu halten. Mehrere Fallberichte deuten darauf hin, dass eine fehlende O2-Regulierung negative Folgen haben kann. Eine randomisierte Studie an Patienten mit akuter CODP-Exazerbation auf dem Weg ins Krankenhaus hat dies eindeutig bewiesen. Im Vergleich zu Patienten ohne Sauerstoffbeschränkung wiesen Patienten, denen zufällig Sauerstoff zur Aufrechterhaltung der SpO2 im Bereich von 88–92 % zugewiesen wurde, eine deutlich niedrigere Sterblichkeitsrate auf (7 % gegenüber 2 %).
ARDS und BPD. Sauerstofftoxizität ist seit langem mit der Pathophysiologie von ARDS assoziiert. Bei Säugetieren kann die Exposition gegenüber 100 % Sauerstoff zu diffusen Lungenschädigungen und schließlich zum Tod führen. Bei Patienten mit schweren Lungenerkrankungen ist es jedoch schwierig, den genauen Nachweis einer Sauerstofftoxizität von den durch Grunderkrankungen verursachten Schäden zu unterscheiden. Darüber hinaus können viele entzündliche Erkrankungen eine Hochregulierung der antioxidativen Abwehrfunktion bewirken. Daher konnten die meisten Studien keinen Zusammenhang zwischen übermäßiger Sauerstoffexposition und akuter Lungenschädigung oder ARDS nachweisen.
Die pulmonale hyaline Membranerkrankung ist eine Erkrankung, die durch einen Mangel an oberflächenaktiven Substanzen verursacht wird und durch Alveolarkollaps und Entzündungen gekennzeichnet ist. Frühgeborene mit hyaliner Membranerkrankung müssen typischerweise hohe Sauerstoffkonzentrationen inhalieren. Sauerstofftoxizität gilt als Hauptfaktor in der Pathogenese der BPD und tritt sogar bei Neugeborenen auf, die keine künstliche Beatmung benötigen. Neugeborene sind besonders anfällig für Sauerstoffschäden, da ihre zellulären antioxidativen Abwehrfunktionen noch nicht vollständig entwickelt und ausgereift sind. Die Frühgeborenenretinopathie ist eine Erkrankung, die mit wiederholtem Hypoxie-/Hyperoxie-Stress einhergeht, und dieser Effekt wurde bei der Frühgeborenenretinopathie bestätigt.
Der synergistische Effekt der pulmonalen Sauerstofftoxizität
Es gibt verschiedene Medikamente, die die Sauerstofftoxizität verstärken können. Sauerstoff erhöht die durch Bleomycin produzierten ROS und inaktiviert die Bleomycinhydrolase. Bei Hamstern kann ein hoher Sauerstoffpartialdruck Bleomycin-induzierte Lungenschäden verschlimmern. Fallberichte beschreiben auch ARDS bei Patienten, die mit Bleomycin behandelt wurden und während der perioperativen Phase hohen FIO2-Werten ausgesetzt waren. Eine prospektive Studie konnte jedoch keinen Zusammenhang zwischen hoher Sauerstoffkonzentration, vorheriger Bleomycin-Exposition und schwerer postoperativer Lungenfunktionsstörung nachweisen. Paraquat ist ein kommerzielles Herbizid, das die Sauerstofftoxizität ebenfalls verstärkt. Daher sollte bei Patienten mit Paraquat-Vergiftung und Bleomycin-Exposition die FIO2 so weit wie möglich minimiert werden. Weitere Medikamente, die die Sauerstofftoxizität verstärken können, sind Disulfiram und Nitrofurantoin. Protein- und Nährstoffmangel kann zu hohen Sauerstoffschäden führen, was auf einen Mangel an thiolhaltigen Aminosäuren, die für die Glutathionsynthese entscheidend sind, sowie auf einen Mangel an den antioxidativen Vitaminen A und E zurückzuführen sein kann.
Sauerstofftoxizität in anderen Organsystemen
Hyperoxie kann toxische Reaktionen an Organen außerhalb der Lunge hervorrufen. Eine große multizentrische retrospektive Kohortenstudie zeigte einen Zusammenhang zwischen erhöhter Mortalität und hohen Sauerstoffwerten nach erfolgreicher kardiopulmonaler Wiederbelebung (CPR). Die Studie ergab, dass Patienten mit einem PaO2 von über 300 mmHg nach CPR ein Mortalitätsrisikoverhältnis im Krankenhaus von 1,8 (95% KI, 1,8–2,2) im Vergleich zu Patienten mit normalem Blutsauerstoffgehalt oder Hypoxämie aufwiesen. Der Grund für die erhöhte Mortalitätsrate ist die Verschlechterung der Funktion des zentralen Nervensystems nach einem Herzstillstand, der durch eine durch ROS vermittelte hohe Sauerstoffreperfusionsverletzung verursacht wird. Eine aktuelle Studie beschrieb auch eine erhöhte Mortalitätsrate bei Patienten mit Hypoxämie nach Intubation in der Notaufnahme, die eng mit dem Grad des erhöhten PaO2 zusammenhängt.
Für Patienten mit Hirnverletzungen und Schlaganfällen scheint die Sauerstoffgabe ohne Hypoxämie keinen Nutzen zu haben. Eine Studie eines Traumazentrums ergab, dass Patienten mit traumatischer Hirnverletzung, die eine Behandlung mit hohem Sauerstoffgehalt (PaO2 > 200 mmHg) erhielten, im Vergleich zu Patienten mit normalem Blutsauerstoffgehalt bei der Entlassung eine höhere Sterblichkeitsrate und einen niedrigeren Glasgow-Koma-Score aufwiesen. Eine weitere Studie mit Patienten, die eine hyperbare Sauerstofftherapie erhielten, zeigte eine schlechte neurologische Prognose. In einer großen multizentrischen Studie hatte die zusätzliche Sauerstoffgabe an Patienten mit akutem Schlaganfall ohne Hypoxämie (Sättigung über 96 %) keinen Vorteil hinsichtlich der Sterblichkeit oder der funktionellen Prognose.
Bei akutem Myokardinfarkt (AMI) ist die Sauerstoffsupplementierung eine häufig verwendete Therapie, doch der Nutzen der Sauerstofftherapie für solche Patienten ist nach wie vor umstritten. Sauerstoff ist bei der Behandlung von Patienten mit akutem Myokardinfarkt und gleichzeitiger Hypoxämie notwendig, da er Leben retten kann. Der Nutzen der herkömmlichen Sauerstoffsupplementierung ohne Hypoxämie ist jedoch noch nicht klar. In den späten 1970er Jahren wurden in einer doppelblinden randomisierten Studie 157 Patienten mit unkompliziertem akutem Myokardinfarkt eingeschlossen und die Sauerstofftherapie (6 l/min) mit keiner Sauerstofftherapie verglichen. Es zeigte sich, dass Patienten unter Sauerstofftherapie häufiger an Sinustachykardie und einem stärkeren Anstieg der Myokardenzyme litten, es gab jedoch keinen Unterschied in der Sterblichkeitsrate.
Bei Patienten mit akutem Myokardinfarkt und ST-Strecken-Hebung ohne Hypoxämie ist eine Sauerstofftherapie mit 8 l/min über eine Nasenkanüle im Vergleich zur Inhalation von Umgebungsluft nicht vorteilhaft. In einer anderen Studie zur Sauerstoffinhalation mit 6 l/min und der Inhalation von Umgebungsluft gab es keinen Unterschied in der 1-Jahres-Mortalität und den Wiedereinweisungsraten bei Patienten mit akutem Myokardinfarkt. Die Kontrolle der Blutsauerstoffsättigung zwischen 98 % und 100 % und 90 % und 94 % hat keinen Nutzen bei Patienten mit Herzstillstand außerhalb des Krankenhauses. Die potenziellen schädlichen Auswirkungen einer hohen Sauerstoffsättigung auf einen akuten Myokardinfarkt umfassen Koronararterienverengung, gestörte Mikrozirkulationsdurchblutung, erhöhten funktionellen Sauerstoff-Shunt, verringerten Sauerstoffverbrauch und erhöhte ROS-Schäden im Bereich der erfolgreichen Reperfusion.
Schließlich wurden in klinischen Studien und Metaanalysen die geeigneten SpO2-Zielwerte für schwerkranke Krankenhauspatienten untersucht. In einer einzigen, offenen, randomisierten Studie an einem Zentrum wurde die konservative Sauerstofftherapie (SpO2-Zielwert 94–98 %) mit der herkömmlichen Therapie (SpO2-Wert 97–100 %) verglichen. 434 Patienten auf der Intensivstation verglichen diese Studie. Die Sterblichkeitsrate auf der Intensivstation der Patienten, die nach dem Zufallsprinzip einer konservativen Sauerstofftherapie zugewiesen wurden, hat sich verbessert; Schock, Leberversagen und Bakteriämie treten seltener auf. Eine anschließende Metaanalyse umfasste 25 klinische Studien mit über 16.000 Krankenhauspatienten mit unterschiedlichen Diagnosen, darunter Schlaganfall, Trauma, Sepsis, Herzinfarkt und Notoperationen. Die Ergebnisse dieser Metaanalyse zeigten, dass Patienten mit konservativer Sauerstofftherapie eine erhöhte Sterblichkeitsrate im Krankenhaus aufwiesen (relatives Risiko 1,21; 95 % KI 1,03–1,43).
Allerdings konnten in zwei darauffolgenden groß angelegten Studien keinerlei Auswirkungen konservativer Sauerstofftherapiestrategien auf die Anzahl der Tage ohne Beatmungsgerät bei Patienten mit Lungenerkrankungen oder auf die 28-Tage-Überlebensrate bei ARDS-Patienten nachgewiesen werden. Eine kürzlich durchgeführte Studie mit 2541 mechanisch beatmeten Patienten ergab, dass eine gezielte Sauerstoffsupplementierung innerhalb dreier verschiedener SpO2-Bereiche (88–92 %, 92–96 %, 96–100 %) keine Auswirkungen auf Ergebnisse wie Überlebenstage, Sterblichkeit, Herzstillstand, Arrhythmie, Myokardinfarkt, Schlaganfall oder Pneumothorax ohne mechanische Beatmung innerhalb von 28 Tagen hatte. Auf Grundlage dieser Daten empfehlen die Leitlinien der British Thoracic Society für die meisten erwachsenen Krankenhauspatienten einen SpO2-Zielbereich von 94–98 %. Dies ist plausibel, da die SpO2 innerhalb dieses Bereichs (unter Berücksichtigung des Fehlers von ± 2–3 % bei Pulsoximetern) einem PaO2-Bereich von 65–100 mmHg entspricht, der für den Sauerstoffgehalt im Blut sicher und ausreichend ist. Bei Patienten mit dem Risiko einer hyperkapnischen Ateminsuffizienz sind 88 % bis 92 % ein sichereres Ziel, um eine durch O2 verursachte Hyperkapnie zu vermeiden.
Beitragszeit: 13. Juli 2024